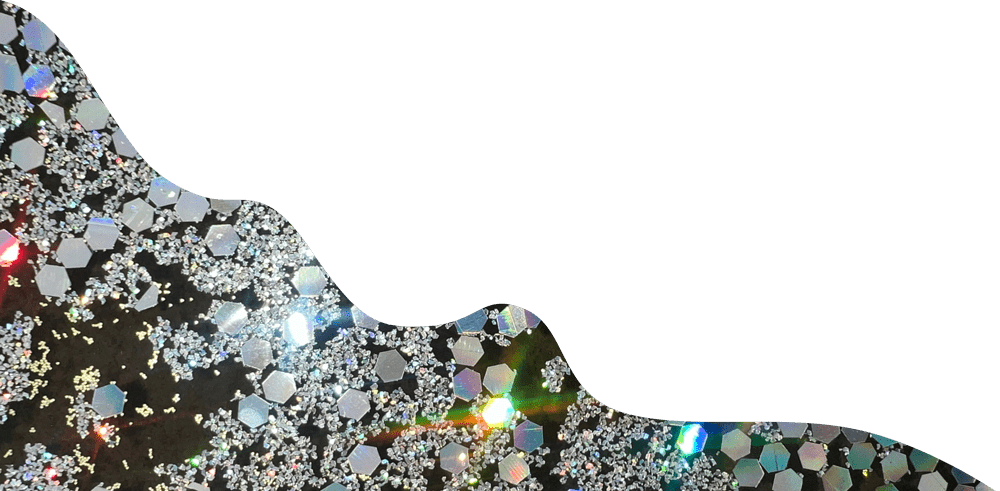Camp Stories – Teil 2
Kings and Queens…and Balls!
Zur Begriffs- und Diskursgeschichte von Camp
Julia Pennauer, 29.4.2024.
Teil zwei der Camp Stories führt in die Molly Häuser Londons und in das „House of Swann“ in Washington. Im Anschluss an den letzten Teil der Serie suchen wir zunächst das Camp-„Fantasma Versailles“ auf.
Drama Kings – Drama Queens.
Der bisherige Abriss zur Begriffsgeschichte Camps führt von (schein)-aristokratischen theatralen Posen in Versailles über die genderqueeren „Unternehmungen“ viktorianischer Drag Queens zu Übertreibungen mangelhafter Charaktere; Exceptional want of character – etwas Abwesendes, Unsichtbares wirft sich repräsentativ in Schale, „donnert sich auf“.
Es ist davon auszugehen, dass frühe anglophone queere Subkulturen den nach bürgerlichen Normen zunehmend als frivol und „effeminiert“ geltenden aristokratischen Geschmack appropriierten: Posen, Pomp und (offensichtlicher) Manierismus werden zur geheimen Ausdrucks-, und Verständigungsform, insbesondere – jedoch nicht nur – durch homosexuelle Männer.
Immer wieder dienen im Laufe der (Mode-)Geschichte dekorativer Exzess, das Protzige, das müßig-luxuriös Überflüssige (oder was als solches rezipiert wird) als Referenzpunkte anti-bürgerlicher Ästhetiken, wie später auch zu finden bei manchen proletarischen Jugend-Subkulturen.
Prunk, Theatralität und Ornament eignen sich, sobald von ihrer ursprünglichen repräsentativen Funktion befreit, als „Darstellungsmittel individueller Phantasien, Mythologien, Tagträumen und unverschlüsselter Sinnlichkeit“1. Laut Marc Booth dient der Fantasieraum Versailles (versus dem konkreten Versailles als Ort historischer Macht und Gewaltausübung) als häufiger Referenzpunkt von Homo-Protocamp – also „excessive dress, emphasis on social performance and display, cultivated poise“.

Ludwig XIV. der balletttanzende Sonnenkönig.
Das imaginierte Camp-Versailles hat mit dem imperialen Versailles, wo der Prunk noch eine politische Funktion hatte, laut Marc Booth, wenig gemein. Es sind auch nicht konkrete historische Referenzen oder Personen, die die Camp Fantasie bewegen. Trotzdem bietet sich das phantasmagorische kulturelle Nachleben mancher Bewohner_innen Versailles zur „Vercampung“ an; zum Beispiel der Ballett-König Ludwig XIV, der Politik und Pomp als Gesamtkunstwerk, mit ihm selbst in der Hauptrolle, inszenierte. Oder sein Bruder Philippe von Orléans, dessen notorisches Cross-Dressing in den Transvestite Memoirs of The Abbe de Choisy (1737) festgehalten ist. Oder Marie Antoinette, die mit ihren modischen Improvisationen unabsichtlich die „gottgewollte“ absolutistische Ordnung dekonstruierte, als sie Unterwäsche als Überwäsche trug und in ihrem Kleidungsstil die antagonistischen Pole „Herrscherin“ und „Schauspielerin/Mätresse“ vermischte.2

Fashion-Queen Marie-Antoinette mit Drag Hair- wahrscheinlich von ihrem Lieblingsfriseur Léonard-Alexis Autié, besser bekannt als Monsieur Léonard. Diesen „Sohn einfacher Kaufleute“ erhob sie zum Star und räumte ihm sogar teilweise Privilegien gegenüber dem Hofstaat ein.
Marie Antoinette überdauert im kulturellen Bewusstsein – den fingierten Kuchen sei Dank – als Inbegriff privilegierter Ignoranz (was sie, genauso wie die männlichen adeligen Machthaber, wahrscheinlich auch war). Doch nicht nur das. Sie spukt, laut Barbara Vinken, vor allem als misogyn geprägte Vorstellung einer „weibischen“ lustbesessenen Aristokratie durch die Jahrhunderte. Damit steht sie auch als Gegenentwurf zur bescheidenen „Mutter und Hausfrau“ wie auch zu bürgerlicher Tugendhaftigkeit.
Was die Camp Imagination interessiert ist nicht das tatsächliche imperiale Versailles, wo der Prunk noch eine politische Funktion hatte. Es sind auch nicht konkrete historische Personen und Referenzen; Es ist nicht der Ballett-König Ludwig XIV, der Politik und Pomp als Gesamtkunstwerk, mit ihm selbst in der Hauptrolle, inszenierte. Es ist nicht mal sein Bruder Philippe von Orléans, dessen notorisches Cross-Dressing in den Transvestite Memoirs of The Abbe de Choisy (1737) festgehalten ist. Es ist auch nur sehr bedingt das phantasmagorische kulturelle Nachleben von Marie Antoinette, die mit ihren modischen Improvisationen unabsichtlich die „gottgewollte“ Ordnung dekonstruierte (denn sie trug Unterwäsche als Überwäsche und mixte in ihrem Stil „Herrscherin“, „Schauspielerin“, und „Mätresse“).
Es ist laut Marc Booth also nicht das echte Versailles als „symbol of decorative absolutism“, das die frühe Camp Fantasie beflügelt, sondern ein imaginäres Camp-Versailles als „symbol of absolute decorativism“3. Zu Deutsch: Frühe queere Subkulturen vercampten den dekorierten Absolutismus zu einer Verabsolutierung des Dekorativen.
Ich würde Booth entgegensetzten, dass es hier nicht um das Primat des Dekorativen geht, also nicht darum, dekorativen Stil über einen als Gegensatz konstruierten Inhalt oder Essenz zu stellen. Es geht darum, dass dekorative Ornamente und theatrale Maskeraden im Laufe der Zeit für Neubesetzungen und spielerisch humorvolle Aneignungen und Zurückweisungen frei geworden sind.

Louis Quatorze Stil
Die zunehmende bürgerliche Bewertung des Repräsentativ-Dekorativen als „weibisch“ verdient gesonderte Aufmerksamkeit. Sie scheint darauf zurückzugehen, dass man die „schöne“ modische Repräsentation in dem Moment, wo sie von der Macht entkoppelt wurde, an Frauen delegierte. Das neue, bürgerlich männliche Macht-Subjekt ist ganz Interiorität, Arbeit am „Geistigen“. Männer erscheinen nicht mehr, sie sind einfach. Der machttragende bürgerliche weiße Mann verschwindet zunehmen für lange Zeit körperlos im symbolisch „neutralen“ Anzug. Körper, die angesehen werden, sind die „der anderen“: Frauen, Schwule, rassifizierte Personen aus kolonisierten Weltgegenden. Nur gelegentlich ist auch der modelos-maskuline nackte Arbeiter als Kraftmaschine Gegenstand der Betrachtung…no homo natürlich!
Sich dem Angesehen-Werden offensichtlich preiszugeben droht nun „effeminate“, „phony“ zu sein. Das modische (erotische) Zeigen, das an körperliche Metamorphosen, und das Verwiesensein auf andere erinnert, wird für Männer nun lächerlich, „tuntig“. Von der Macht entkoppelt, wird modische Repräsentation gefällig, pretty. Sie wird fetisch-förmig, kotrolliert, steril normiert…ein Spektakel, das selbst ohne (fordernden) Blick bleibt.
Heutige Drag Kings und Queens, aber auch die campen Diven vieler Schaubühnen, erzählen von Spektakeln, die zurückschauen, fordern, mit Erwartungen spielen. Sie sind umhüllt von prachtvollen Maskeraden, die raumgreifend und raumgestaltend sind, Distanz und Aufmerksamkeit schaffen. Sie können gleichzeitig grotesk und lieblich, mächtig und pretty sein, voll geistreichem Witz und komischer Körperlichkeit. Camp verunreinigt hierarchisch aufgeladene ästhetische Grenzen.
Zurückkommend auf die historische, von Booth beschriebene Proto-Camp Kultur, stellt sich die Frage, in welchen subkulturellen Formationen Prunk und Queenness transformiert, angeeignet und in dieser neuen Camp-Form weitergetragen wurden. Als zentraler Schauplatz der „effeminate“- und homosexuellen Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts mögen die Mollie Häuser hier eine wichtige Rolle gespielt haben.
Mollies
„Good Golly Miss Molly! Yeah, you sure like to ball!” wusste 1958 schon Little Richard, der androgyne Rock’n‘ Roll Pionier mit Drag Vergangenheit.
Die Kultur der Molly Häuser florierte ab ca. 1700 sowohl als Hort früher Camp Praxen, Drag-Shows und Wettbewerbe, als auch stellten sie die Hinterzimmer für sexuelle Kontakte homosexueller und gender-nonkonformer Männer bereit.
„Mollyhouses“ waren auch jene erstaunlich klassenübergreifenden Schauplätze diverser trans- und genderqueeren Expressionen, über die wahrscheinlich Fanny und Stella (siehe Teil 1), das Wort „camp“ erreichte. Die Hinterstuben der Molly Coffeehouses die von 1800-1830 ihre Hochblüte erlebten, waren mit eigenen Kapellen für rituelle symbolische, wie auch parodistische Hochzeiten ausgestattet.
In kommunalen Praktiken, die sowohl Identitäten stiften, als auch hinterfragen, wurden alternative Wahlfamilien aus „Sisters“, „Husbands“, „Mothers“, „Children“ gegründet und erprobt. In dieser Hinsicht, und auch was den fluiden Übergang zwischen Publikum und Performenden betrifft, findet sich eine Kontinuität queerer Performancekultur von den Molly Houses zu den legendären latin- und afroamerikanischen „Houses“ in New Yorks Harlem. In queeren Schutzräumen dient theatrales Rollenspiel als Form von Ermächtigung, Erneuerung und Sichtbarkeit, in dem sich normative und parodistische Elemente spielerisch finden.
Mother Clap und Miss Muff

Es gibt keine Darstellungen der Molly Subkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Dieses satirische Cartoon von Crossdressers dient hier als spekulativer Platzhalter.
Drehscheibe eines der berüchtigtsten Mollyhäuser der 1720er Jahre – Mother Clap’s – war eine Frau. Die Unternehmerin Margaret Clap brachte der homosexuellen Community große Sympathie entgegen, deckte ihre Kundschaft durch Falschaussagen, und stellte Betten bereit für Männer, die teilweise jahrelang in ihrem Etablissement untergebracht waren. Wie große Teile ihrer Kundschaft, wurde sie nach einer Polizeirazzia 1726 an den Pranger gestellt (nicht metaphorisch, sondern an den wörtlichen Holzpfosten) und in Folge zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zwei Männer, die man in flagranti in Mother Clap’s erwischt hatte, wurden gehängt.
Ein ähnliches Ende fand das Molly House von Jonathan Muff alias Miss Muff. Wie Miss Muff nahm auch die übliche Molly Kundschaft gerne blumige und adelige Spitznahmen an. Überliefert sind Berichte von einem Fleischer namens The Duchess of Gloucester, einem Lichtzieher namens Dip-Candle Mary, einem Kellner namens Lady Godiva, einem Seifenhersteller namens Aunt England usw. Miss Muff wurde im Zuge einer Polizeirazzia festgenommen, woraufhin The Weekly Journal or British Gazetteer am 5.10.1728 berichtete:
„On Sunday Night a Constable with proper Assistants, searched the House of Jonathan Muff, alias Miss Muff, in Black-Lyon Yard, near Whitechapel Church, where they apprehended nine male Ladies, including the Man of the House.“ [Hervorhebung durch die Autorin].
Während Zeitungsartikel, Gerichts- und Polizeiakte einen, wenn auch sehr unvollständigen, Einblick in subkulturelle Performance Praktiken homosexueller Männer gewähren, ist über eine mögliche Camp-Praxis von (queeren) Frauen oder aus dem 18. Jahrhundert wenig dokumentiert. Ob Unternehmerinnen wie Margaret Clap, die immerhin ein Molly Haus führte und verwaltete (siehe oben), an den Drag Spektakeln ihres Hauses partizipierte ist nicht bekannt. Auch welche theatralen Praktiken in den Hinterzimmern bürgerlicher und aristokratischer „Freundinnen“ möglicherweise stattfanden, blieb dem öffentlichen Blick verborgen. Polizeiakte berichten lediglich über die Festnahme von oft zurückgezogen lebenden crossdressenden „female husbands“, die mit harten Strafen rechnen mussten, ebenso wie Frauen, die sich verkleideten, um größere Freiheit und Mobilität zu erlangen.4 Einige wenige Überlieferungen aus dem 18. Jahrhundert berichten von lesbischen Straßen-Subkulturen unter britischen Prostituierten. Der extrem breite Prostitutionsbegriff dieser Zeit beinhaltet nicht primär Sexarbeit, sondern alle vermeintlichen Übertretungen von Frauen aus der neuen Urban Poor Klasse, die in „ungeregelten“ Verhältnissen lebten. Die ökonomisch schwach gestellten und vulnerablen „Prostituierten“ schlossen sich mitunter zum Selbstschutz in Gruppen zusammen. Als solche arbeiteten sie ohne übergeordneten „Pimps“, überfielen oft Männer auf der Straße oder entlockten diesen ihre Geldbeutel. Diese Gruppen sind im obigen Kontext insofern interessant, als Mollie (hergeleitet aus Moll – eine low class woman ohne sexuelle Moral) im 18. Jahrhundert gleichzeitig eine Prostituierte und einen homosexuellen Mann bezeichnet. (Erwähnenswert scheint dazu, dass laut Leo Bersani, Prostituierte des 19. Jahrhunderts im öffentlichen Diskurs ähnlich konstruiert wurden wie später schwule Männer: als ausgestattet mit einer unersättlichen, subjektauflösenden, zerstörerischen Sexualität. Eine Konstruktion, die sich im Rahmen der AIDS-Epidemie noch verstärkte). Darüber, ob die Gemeinsamkeiten zwischen den zum Frauenbund zusammengeschlossenen Molls auf Englands Straßen und den Molly House-Gästen über die Wortverwandtschaft hinausgehen, kann nur gerätselt werden. Die erste berühmte britische Männerimitatorin Vesta Tilley5 (1864-1952) wurde erst über hundert Jahre nach „Miss Muffs“ Festnahme geboren. Tilley veräppelte in ihren Drag Darstellungen oft Polizisten, was den schikanierten weiblichen Molls, „female husbands“, (queeren) „Amazonen“ des 18. Jahrhunderts wohl gefallen hätte dürfen. Vielleicht wird ja zu deren kulturellen Praktiken eines Tages auch ein Dokument gefunden, das queere Geschichte nochmals ähnlich neu schreibt, wie die jungen Entdeckungen des Historikers Channing Joseph. Dieser fand vor wenigen Jahren bei seiner Recherche zu William Dorsey Swann ein außergewöhnliches Zeugnis frühen schwarzen queeren Widerstands in den USA.
House of Swann
William Dorsey Swann (1860-1925) verdient als erste selbsternannte „Queen of Drags“ (ja, die kurzlebige deutsche Drag Casting Show von Heidi Klum hieß komischerweise genauso) einen Platz in dieser Geschichte. – Dass Swann seine ersten Lebensjahre in Maryland in Sklaverei verbringen musste, ist nur der Anfang einer Biografie voll von gravierendem Unrecht. Über die Jugend Swanns ist außer dem Inhalt eines Polizeiberichts wenig bekannt. Darin wird festgehalten, dass Swann versuchte, Bücher aus der Washington Library für seine Weiterbildung zu klauen.
Später veranstaltete „Mother Swann“ in Washington auch Travestie Bälle, in denen unter anderem der Cake Walk getanzt wurde. Solche „Prize Walks“6 waren Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Plantagen entstanden. Versklavte machten sich in diesen Tänzen über die steifen festlichen Bräuche und Gepflogenheiten der weißen Sklavenhalter lustig. (Ironie und Dummheit in dieser Geschichte ist, dass weiße Blackface Performer diesen Tanz später wiederum bei Minstrel Shows aufgriffen, um schwarze Menschen zu karikieren). Drag und campe Posen waren immer auch schon von Klassen- und rassifizierenden Konflikten durchzogen (und zwar auf beiden Seiten der Unterdrückung, wie sich später zeigen wird).

Von Swann sind keine Bilder überliefert. Diese symbolische Postkarte von 1903 zeigt eine Drag und Cakewalk Performance.
Bei einem Drag Ball in ihrem Haus wurde Mother Swann gemeinsam mit 17 anderen anwesenden Gästen verhaftet. Swann leistete Widerstand und soll dem amtshandelnden Polizisten „You is no gentleman!“ entgegnet haben. Es folgte eine zehnmonatige Gefängnisstrafe, in deren Rahmen Swann eine schriftliche Selbstverteidigung samt Petition verfasste – eines der ersten LGBTQ-Dokumente dieser Art. Obwohl Freunde zahlreich unterschrieben, blieb die Petition unerhört und der US Staatsanwalt A. A. Birney entgegnete in einem Gutachten:
“This petition is wholly without merit. While the charge of keeping a disorderly house does not on its face differ from other cases in which milder sentences have been imposed, the prisoner was in fact convicted of the most horrible and disgusting offences known to the law; an offence so disgusting that it is unnamed. This is not the first time that the prisoner has been convicted of this crime, and his evil example in the community must have been most corrupting.”
Was ist dieses namenlose Verbrechen? Worin bestand Swanns unaussprechliche Übertretung? Fällt sie in eine ähnliche Kategorie wie “the love that dare not speak its name”- ein Euphemismus für Homosexualität aus dem Gedicht „Two Loves“ (1892), das Alfred Douglas für seinen Geliebten Oscar Wilde verfasste? Während die Verurteilung von Swann samt befreundeter afroamerikanischer Drag Queens kaum öffentliche Beachtung erlangte, fand fast zeitgleich in Großbritannien einer der größten „Sodomie“-Skandale aller Zeiten statt. Auch Alfred Douglas Gedicht über die unaussprechliche Liebe wurde im Prozess gegen Oscar Wilde als Beweismaterial herangezogen. Von diesem handelt unter anderem der dritte und letzte Teil der Camp Stories.
Literatur:
1 Fuchs, Rainer: „Ornament: Zum Inhalt des Inhaltslosen“. In: „Maria Hahnenkamp“ , Salzburger Kunstverein (Hrsg.), Schlebrügge. 2009, S. 111.
2 Vinken, 2013. S.67-69.
3 Booth, Mark: “Campe-toi! On the Origins and Definitions of Camp.” In: Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject – A Reader. Fabio Cleto (Hrsg.). Edinburgh: UP, 2008. S.79.
4 Norton, Rictor: „Lesbian Marriages in 18th century England“, Lesbian History, 18 August 2009, updated 11 February 2010 http://rictornorton.co.uk/eighteen/lesbmarr.htm
5 Siehe beispielsweise Tilleys Performance „It’s part of a policeman’s duty“ (1907)-> YouTube Link
6 Siehe beispielsweise Library of Congress, „Cake Walk“ -> YouTube Link
Norton, Rictor: „Mother Clap’s Molly House“, The Gay Subculture in Georgian England, 5 February 2005 <http://rictornorton.co.uk/eighteen/mother.htm>.
Henderson, Tony: Disorderly Women in Eighteen-Century London Prostitution and Control in the Metropolis, 1730-1830. Routledge. 1999.
William Dorsey Swann, the Queen of Drag: https://rediscovering-black-history.blogs.archives.gov/2020/06/29/william-dorsey-swann-the-queen-of-drag/
Vinken, Barbara: Angezogen. Das Geheimnis der Mode. Klett-Cota. 2013.